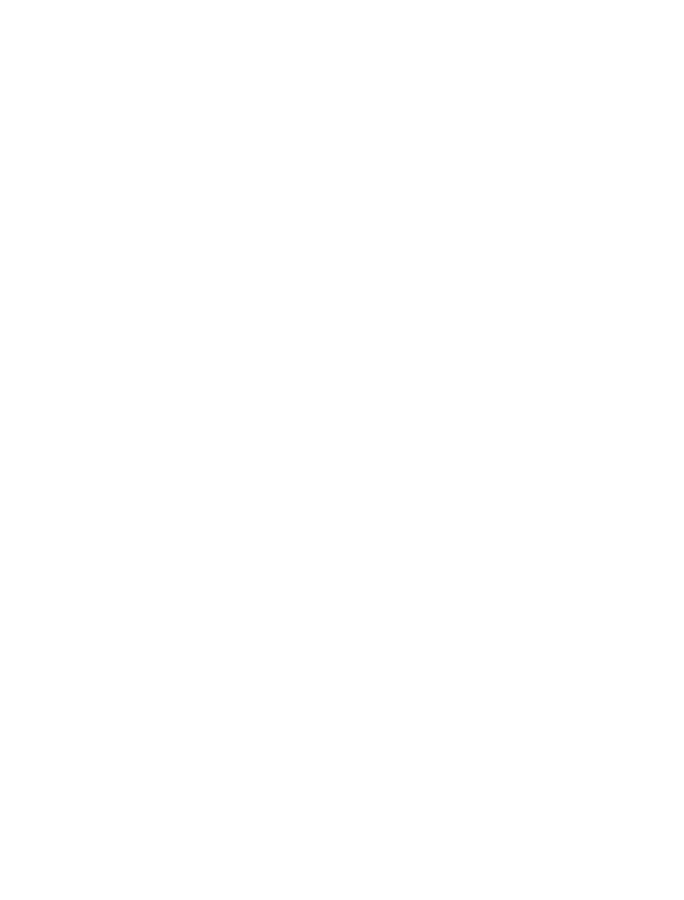Würde
Gastbeitrag von Bruno Rodrigues Rogga
Gerald Hüther, geboren 1951, zählt zu den renommiertesten Hirnforschern Deutschlands. Als Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung widmet er sich der Erforschung des menschlichen Potenzials und teilt sein Wissen durch Bücher, Vorträge und Beratungstätigkeiten für Politiker und Unternehmer sowie regelmäßige Auftritte in Rundfunk und Online-Medien. Sein bahnbrechendes Werk „Würde – Was uns stark macht – als Einzelne und als Gesellschaft“ bildet die Grundlage für meinen folgenden Blogbeitrag.
Würde, Dignitas, Dignite, Dignidad, Dignity! Wer sich seiner eigenen Würde bewusst wird, ist nicht mehr manipulierbar. Indem man seine eigene Würde erkennt, vermeidet man die Verletzung anderer Menschen, da man gleichzeitig die eigene Würde achtet. Doch was genau bedeutet Würde?
Heute verstehen wir darunter im Allgemeinen ein sogenanntes Leistungsrecht. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ So lautet Artikel Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Durch die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 wird dieser Grundsatz gesichert: Jeder Mensch hat Anspruch auf Achtung, unabhängig von seinen Eigenschaften, seinem körperlichen oder geistigen Zustand, seinen Leistungen oder seinem sozialen Status. Das Grundgesetz schützt somit vor Erniedrigung, Ausgrenzung, verfolgung, Stigmatisierung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder den Staat selbst. Die Vorstellung von der Würde des Menschen fungiert daher als Leitfaden im Leben, als Erinnerung und als Stütze. Diese Vorstellung, dass jeder Mensch Würde besitzt, bildet die Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft. Die Bürger demokratischer Gesellschaften benötigen eine innere Orientierung, an der sie ihr Handeln , ihre Lebensführung und ihr Zusammenleben ausrichten können. Des Weiteren begegnet uns der Begriff „Würde“ auch im Deutschunterricht in Schulen. Hier wird er eher mit Grammatikübungen in Verbindung gebracht, insbesndere mit der Konjunktivform: er, sie, es würde etwas tun. Diese Form dient dazu, Möglichkeiten auszudrücken und ist neben dem Indikativ und dem Imperativ einer der drei Modi des verbs. Würde ermöglicht es uns also, über Wünsche und Möglichkeiten zu sprechen, darüber, was sein könnte. Ich würde gerne dies haben und das machen.
In den erwähnten Schulen wird jedoch oft die Würde mit den Füßen getreten. Entdeckungsfreudige, lernwillige und kreative Kinder werden vor allem in staatlichen Bildungseinrichtungen traumatisiert, indem sie nicht als proaktive Gestalter ihres eigenen Seins agieren dürfen, sondern verwaltet werden. Jedes Kind bringt bereits ein angeborenes Gespür dafür mit, was es braucht, um seine Menschlichkeit zu entfalten. Doch spätestens in den Schulen werden Kinder wie Objekte behandelt. Sie finden dort eine Umgebung vor, die von Erwachsenen nach deren Absichten und Zielen gestaltet wurde. Sie werden von Erwachsenen unterrichtet, belehrt, kontrolliert, geprüft und bewertet, als wären sie formbare Objekte der Gesellschaft. Kein Wunder also, dass die Lust am Lernen dadurch erlischt. Wie soll jemand, der von Kindesbeinen an ständig vorgegeben bekommt, was er wie zu tun hat, auf dem Weg zum Erwachsenwerden herausfinden, wer er wirklich ist, was ihn interessiert und was für ein Mensch er sein möchte? Zu oft verlassen junge Menschen die Schule als leidenschaftslose Pflichterfüller.
Doch sobald jemand von anderen Personen benutzt und zum bloßen Objekt degradiert wird, spürt er eine Bedrohung seiner Würde. Das ist eine äußerst quälende Erfahrung. Wer sich von anderen als reiner Gegenstand ihrer Absichten, Erwartungen, Bewertungen oder gar ihrer Anweisungen und Maßnahmen betrachtet fühlt, gerät in die Falle der Subjektlosigkeit und sieht seine Würde in Gefahr. Die Behandlung als Objekt verletzt dabei grundlegende menschliche Bedürfnisse nach Verbundenheit und Zugehörigkeit, ebenso wie nach Selbstbestimmung und Freiheit. Unter solchen Umständen werden im menschlichen Gehirn dieselben neutralen Netzwerke aktiviert, die auch bei körperlichen Unannehmlichkeiten in Aktion treten. Dieser Prozess manifestiert sich nicht nur in Schulen, sondern auch im familiären Umfeld, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz. Doch wie reagieren Menschen auf solch schmerzhafte Erfahrungen?
Wer selbst zum Objekt degradiert wurde, neigt dazu, andere ebenfalls als bloße Mittel zum Zweck zu betrachten und für die eigenen Interessen auszunutzen. Eine weitere Reaktion besteht darin, sich selbst als minderwertig, ungeliebt oder unfähig anzusehen und sich somit selbst zum Gegenstand eigener negativer Bewertungen zu machen. Oder wir lassen uns von der Ablenkungsindustrie ablenken und konsumieren, um nicht über unsere Probleme nachdenken zu müssen. Verdrängung, Ablenkung, künstliche Aufregung und das Abtauchen sind ebenfalls gängige Strategien. Leider setzen viele Menschen ihre Hoffnungen auf eine Lösung durch die Wahl einer neuen Regierung. In der heutigen politischen Arena erleben wir eine narzisstische Reaktion auf die schmerzhafte Erfahrung der Objektifizierung. Es entstehen Feindbilder, die dazu dienen, eigene Erwartungen, Ziele, Maßnahmen und Forderungen zu artikulieren. Beispiele hierfür sind die Forderungen nach Waffenlieferungen in die Ukraine, die Russland zum Feind erklären, sowie die Woke-Ideologie, die oft Andersdenkende vom Diskurs ausschließt, anstatt sich inhaltlich auszutauschen. Personen, die diese Erwartungen nicht erfüllen, werden diffamiert und ausgeschlossen.
Doch wie können wir dem entgegenwirken, diesem Leben im falschen Sein? Die Bewusstwerdung unserer eigenen Würde stellt den entscheidenden Schritt in die Freiheit dar. Es ist ein Akt der Emanzipation, nicht als Frau, Mann, Schwarz oder Weiß, sondern einfach als Mensch. Wir sollten hinterfragen, ob wir unseren eigenen Zielen nachstreben oder nur die Erwartungen anderer erfüllen. Nach welchen Werten leben wir? Eine weitere Möglichkeit besteht darin, achtsam zu sein, sich nicht mit subjektiven Meinungen zu identifizieren und diese nicht mit Fakten gleichzusetzen. Wir sollten reflektieren, wie wir mit Andersdenkenden und Menschen in anderen Lebensrealitäten und mit unterschiedlichen Lebensgeschichten umgehen. Die Arbeit an unserem eigenen Ich sollten wir selbstkritisch vorantreiben, versuchen ein Vorbild zu sein und Bildung und Weiterentwicklung als stets unvollendeten Prozess betrachten. Was denken Sie?
10. Mai 2024
Gastbeiträge